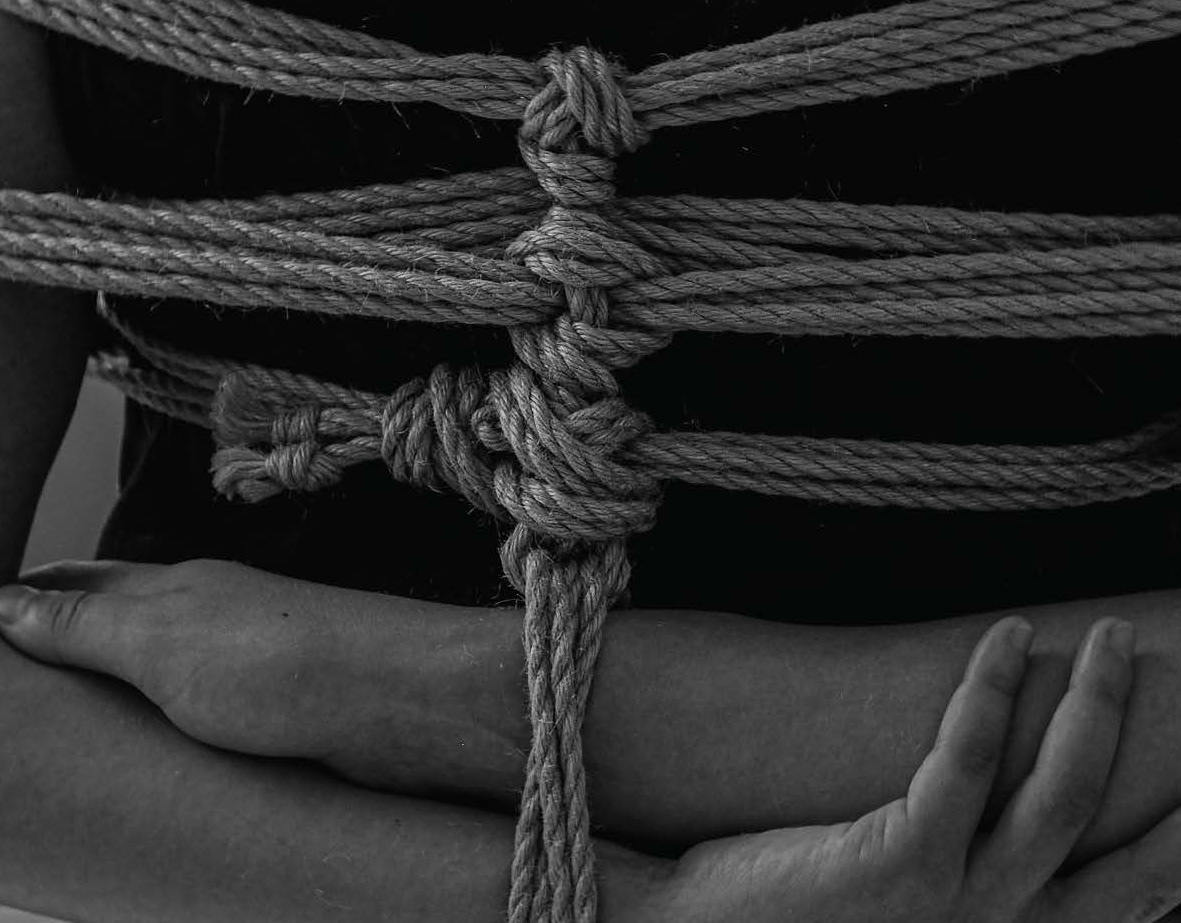Wie eine kleine Gemeinschaft anerkannt werden will
Unterdrückt, verfolgt, vertrieben: Seit der Entstehung des Bahaitums Mitte des 19. Jahrhunderts sind die Mitglieder der Glaubensgemeinschaft – die Bahai – in ihrem Ursprungsland Iran unerwünscht, um nicht zu sagen Staatsfeinde. Eine Prime News Geschichte
Immer wieder wurden sie Opfer von systematischer staatlicher Diskriminierung und Repression. Nach dem Ausbruch der Islamischen Revolution 1978 verschlimmerte sich die Lage: Tausende mussten das Land fluchtartig verlassen und anderswo in der Welt eine neue Heimat finden. Auch in die Schweiz bildeten sich Gruppen von Bahai: in Bern, Zürich, Luzern und ebenso in Basel.
Diesen Juli hat der Grosse Rat nun ein offizielles Gesuch erhalten. Die lokale Bahai-Sektion möchte vom Kanton Basel-Stadt als Religionsgemeinschaft anerkannt werden. «Wir erhoffen uns dadurch mehr Sichtbarkeit in der Region», erklärt Roya Blaser, die gegenüber Prime News als Auskunftsperson auftritt.
Wurzeln liegen im Islam
Doch beginnen wir von vorne: Wer sind eigentlich die Bahai und wofür stehen sie?
Der Name lässt Unkundige zunächst alles Mögliche vermuten: Eine Inselgruppe im Pazifik könnte genauso gut passen wie ein seltenes Gewürz. Nichts davon trifft zu. Das Bahaitum gilt vielmehr – kurz zusammengefasst – als eine universelle Religionsgemeinschaft, die Werte wie Frieden, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und Toleranz gegenüber den Mitmenschen verkörpert (siehe Box am Ende des Artikels).
Die Wurzeln liegen im schiitischen Islam, mit dem die Bahai jedoch nicht viel gemeinsam haben. Kleidervorschriften oder andere gestrenge Vorgaben, die das Alltagsleben bestimmen, sind ihnen fremd. Ihre Geschichte ist noch sehr jung: Das Bahaitum kam erst im 19. Jahrhundert auf und wurde durch zwei Aushängeschilder geprägt. Einer wurde im Iran öffentlich hingerichtet, der andere jahrelang ins Gefängnis geworfen.
Kaum öffentlich bekannt
Von alldem weiss ein Grossteil der Basler Bevölkerung wenig bis nichts. Die Bahai fliegen unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung. Das habe mit der überschaubaren Grösse der Gemeinde zu tun, die rund 100 Mitglieder umfasse, sagt Roya Blaser bei unserem Gespräch.
Wir treffen die zweifache Mutter und inzwischen pensionierte Architektin an einem Dienstagmorgen im Restaurant Murano an der Hardstrasse im Gellert, das sie für das Treffen vorgeschlagen hatte. Blaser, 69 Jahre alt, ist eine unauffällige Erscheinung: Sie trägt ein schwarzes T-Shirt, eine gemusterte weisse Bluse und eine dunkle Hose. Ihre Haare sind braun und kinnlang.
Schon ihre Eltern seien überzeugte Bahai gewesen, erzählt sie. Die Familie litt unter den Ausgrenzungen im Iran und verliess das Land in den Fünfzigerjahren, als der Vater in Manchester eine Stelle als Ingenieur fand. Später führte der Weg in die Schweiz und ans Rheinknie.
Bewusstes Bekenntnis im Jugendalter
Was man wissen muss: Im Unterschied zu den Katholiken oder Reformierten wird bei der Geburt nicht automatisch die Konfession der Eltern übernommen. Zum Bahai wird man ausschliesslich durch selbstbestimmtes Handeln. Ab dem 15. Lebensjahr besteht die Möglichkeit, sich dem Bahaitum anzuschliessen.
Ein unspektakulärer Vorgang, der laut Blaser im Rahmen eines Gesprächs erfolgt und mit keinerlei Ritualen verbunden ist. Sie selbst habe sich im Alter von 16 Jahren zu diesem Schritt entschieden.
Aus der Sicht der Bahai ist jeder Mensch, jedes Tier und jedes noch so kleine Teilchen im Universum gleich wichtig und alle haben ihre eigene Aufgabe. Dieser Einheitsgedanken spiegelt sich auch bei ihrer Sicht auf die Weltreligionen wider, sagt Blaser in fast akzentfreiem Baseldeutsch. «Bei den Bahai glauben wir an das Prinzip der Einheit in der Vielfalt».
Das bedeute, dass man die Überzeugung vertrete, wonach alle grossen Weltreligionen denselben Ursprung haben. Der Unterschied liege lediglich in den verschiedenen Umsetzungen und Lehren. Aus diesem Grund anerkennen und verehren die Bahai alle Religionsstifter wie zum Beispiel Christus, Krishna, Buddha oder auch Bahá’u’lláh, den Stifter der Bahai.
Als wir mit Blaser über die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensmodelle sprechen und den Umgang mit Homosexualität thematisieren, erhalten wir indes Antworten, die nicht zusammenpassen.
Bei aller Offenheit dürften gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten, wenn sie vor der Ehe bereits den Bahai angehörten, hält Blaser einerseits fest. Doch andererseits betont sie, ein solches Ehebündnis müsste dennoch nicht aufgelöst werden: «Das kann ich mir nicht vorstellen, dass bei uns ein solcher Schritt verlangt würde». Ein Widerspruch, der sich nicht auflösen lässt.
Mehr Beachtung dank staatlicher Anerkennung
Ein Gotteshaus oder «Bahai-Zentrum» gibt es in Basel nicht. Die Mitglieder treffen sich in privaten Wohnungen oder mieten für Anlässe Räumlichkeiten, sagt Blaser. Geführt wird die Sektion von einem «Geistigen Rat», einem neunköpfigen Gremium, dem Blaser während mehr als 20 Jahren angehörte.
Der Geistige Rat übernimmt die Aufgaben eines Priesters oder Imams. Das Gremium war es auch, welches beim Kantonsparlament das Gesuch für die kantonale Anerkennung als Religionsgemeinschaft eingereicht hat. Was versprechen sich die Bahai davon?
Es gehe nicht um erhoffte finanzielle Zuschüsse, sagt Blaser. «Mit Spenden und den Mitgliederbeiträgen können wir uns momentan selbst finanzieren». Die staatliche Anerkennung würde aber die Möglichkeit eröffnen, den Bekanntheitsgrad zu steigern und sich «noch stärker mit unseren Projekten und Angeboten in der Gesellschaft einzubringen».
In Basel für die Religionsgemeinden zuständig ist das Finanzdepartement. Wie Generalsekretär Sven Michal auf Anfrage von Prime News erklärt, hätte ein positiver Bescheid durch den Grossen Rat vor allem symbolischen Charakter. Würden die Bahai kantonal anerkannt, wäre dies «Ausdruck der staatlichen Wertschätzung gegenüber dieser Gemeinde».
Die Bahai würden dann «besondere Rechte» verliehen. Der Kanton erhielte aber auch die Autorität, Auflagen zu verfügen.
Besondere Rechte sind zum Beispiel die finanzielle Unterstützung für Tätigkeiten, die im öffentlichen Interesse liegen. Aber auch zur Verfügung stehende Begräbnisplätzen könnte dazugehören, erklärt Michal. Eine Auflage, die der Kanton der Gemeinde machen könnte, wäre zum Beispiel die Offenlegung der Rechnungen.
Sollte das Gesuch der Bahai anerkannt werden, ist die Gemeinde erst die 5. kantonal anerkannte Religionsgemeinschaft in Basel-Stadt. Bisher wurde indes noch kein Gesuch abgelehnt.
Parlament entscheidet im September
Prime News hat auch mit David Atwood, Religionswissenschaftler an der Universität Basel und Koordinator für Religionsfragen gesprochen. Wie ordnet er die Bahai ein?
«Die Bahai sind in der Region Basel eine kleine Gemeinde, die international gut vernetzt und regional verankert ist und sich seit Langem stark im interreligiösen Dialog engagiert», erklärt Atwood. Dies hänge mit ihrer «inklusiven» und «universalistischen» Weltanschauung zusammen.
Aus diesem Grund gehört die Gemeinde seit 2007 dem «Runden Tisch der Religionen beider Basel» an. Dieser bezweckt einen lösungsorientierten Austausch zwischen Religions-Gemeinschaften, Behörden und Bevölkerung. Zu den weiteren Mitgliedern zählen etwa die Evangelisch-Reformierte Kirche oder die Römisch-Katholische Kirche Basel-Stadt.
Wie die Chancen der Bahai für eine kantonale Anerkennung sind, müsse «letztlich das Parlament entscheiden», sagt Atwood gegenüber Prime News. Der Grosse Rat behandelt das Gesuch an seiner Sitzung vom 14. September.
Informationen zu den Bahai
Gebete
Bei den Bahai gibt es verschiedene Gebete. Drei davon sind Pflichtgebete. Eines dieser drei muss mindestens einmal pro Tag für sich gebetet werden. Dafür richten sich die Bahai im Stehen in Richtung ihrer Pilgerstätte «Akkon» in Israel aus.
Bei den Bahai gibt es verschiedene Gebete. Drei davon sind Pflichtgebete. Eines dieser drei muss mindestens einmal pro Tag für sich gebetet werden. Dafür richten sich die Bahai im Stehen in Richtung ihrer Pilgerstätte «Akkon» in Israel aus.
Das «19-Tage-Fest»
Die Bahai folgen dem Sonnenkalender. Das bedeutet, ihr Jahr hat 19 Monate mit je 19 Tagen. Die restlichen vier bis fünf Tage werden zur gegenseitigen Fürsorge genutzt. Der letzte Monat ist ein Fastenmonat. Immer zu Beginn des Monats treffen sich die Bahai zu einer Andachtsfeier (das 19-Tage-Fest), bei der aus religiösen Texten gelesen und zusammen gesungen wird.
Die Bahai folgen dem Sonnenkalender. Das bedeutet, ihr Jahr hat 19 Monate mit je 19 Tagen. Die restlichen vier bis fünf Tage werden zur gegenseitigen Fürsorge genutzt. Der letzte Monat ist ein Fastenmonat. Immer zu Beginn des Monats treffen sich die Bahai zu einer Andachtsfeier (das 19-Tage-Fest), bei der aus religiösen Texten gelesen und zusammen gesungen wird.
Bahai-Stern
Das Symbol der Bahai-Religion ist ein neunstrahliger Stern. Die Zahl 9 steht bei den Bahai für Vollkommenheit und Einheit. Das Symbol kann an einer Halskette oder an einem Armband getragen werden.
Das Symbol der Bahai-Religion ist ein neunstrahliger Stern. Die Zahl 9 steht bei den Bahai für Vollkommenheit und Einheit. Das Symbol kann an einer Halskette oder an einem Armband getragen werden.
Ehe, Sex und Homosexualität
Eine Ehe ist ausschliesslich zwischen Mann und Frau erlaubt. Gleichgeschlechtliche Paare können nicht heiraten. Sexualität ist nur in der Ehe zwischen Mann und Frau vorgesehen. Sollte jemand seine Sexualität auf eine andere Art und Weise ausleben, müssen die Bahai dieser Person jedoch trotzdem mit Respekt begegnen. Grundsätzlich haben sie alle Menschen ohne Vorurteile zu betrachten.
Eine Ehe ist ausschliesslich zwischen Mann und Frau erlaubt. Gleichgeschlechtliche Paare können nicht heiraten. Sexualität ist nur in der Ehe zwischen Mann und Frau vorgesehen. Sollte jemand seine Sexualität auf eine andere Art und Weise ausleben, müssen die Bahai dieser Person jedoch trotzdem mit Respekt begegnen. Grundsätzlich haben sie alle Menschen ohne Vorurteile zu betrachten.