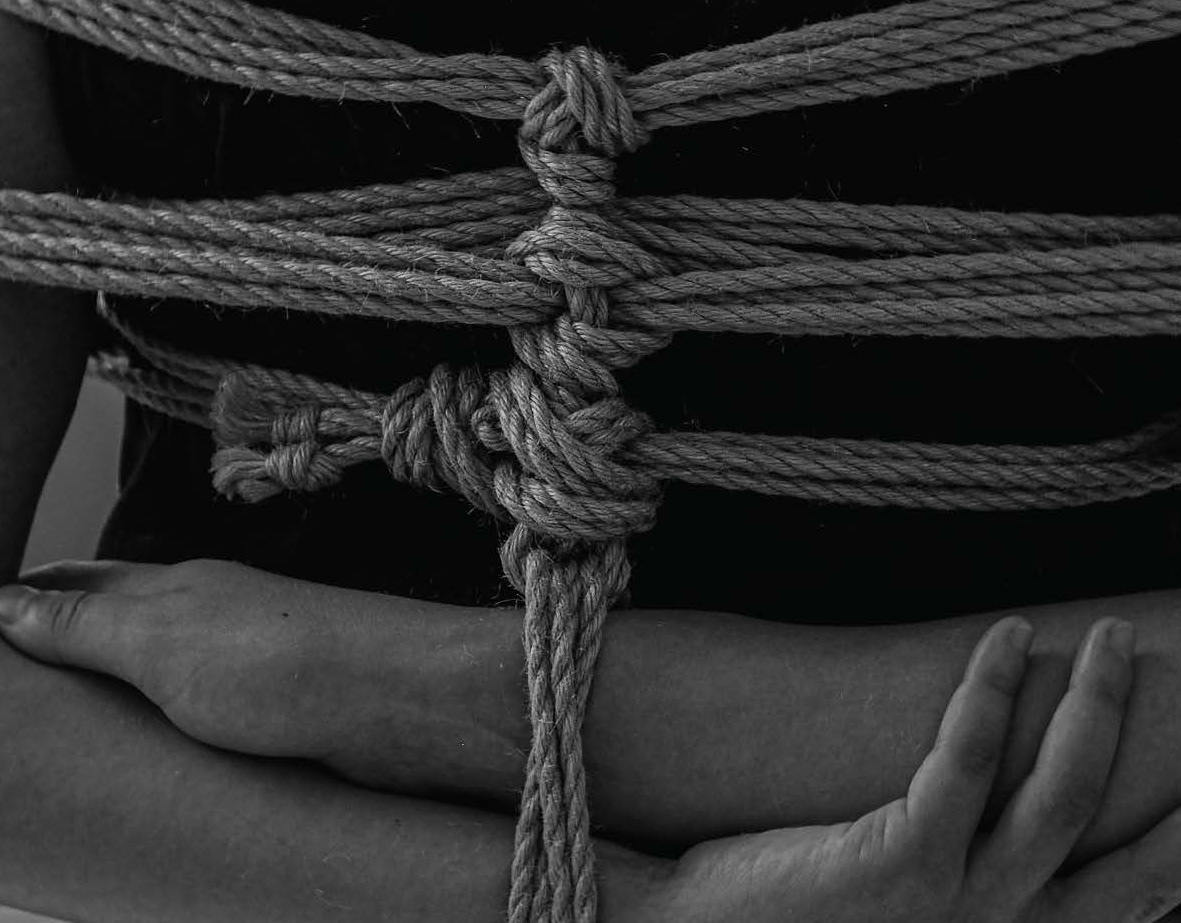Kunsttherapie: Trend oder Wundermittel?
Hinter Pinselstrichen verbergen sich Gedanken, Gefühle und Emotionen. Doch inwiefern kann und soll Kunst ein legitimes Mittel für psychische Probleme und die mentale Gesundheit sein?
Das Atelier im 4. Stock der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) an der Pfingstweidstrasse 96 ist klein. Es ist düster und riecht nach einer Mischung aus Farben, Lack, Holz und Honig. Bei jedem Schritt bleiben die Schuhsohlen unangenehm am Boden kleben und lösen sich mit einem leicht schmatzenden Geräusch. In der Ecke direkt am Fenster steht ein Schreibtisch. Er ist vollgestellt mit kleinen Gläsern, Kisten, Pinseln, Papierschnipseln und Farben. Am Tisch sitzt Künstler:in An Klepel auf einem braunen Stuhl. Mit dem Pinsel in der rechten Hand werden sorgfältig Striche und Formen auf eine Leinwand gemalt. Tief in Gedanken versunken überträgt An die aktuelle Gefühlslage auf die weisse Oberfläche.
«Mit 15 wurde mir immer bewusster, dass ich mich nicht über eine binäre Geschlechtsidentität definieren kann», erklärt An. Während dieser Zeit begann An diesen Prozess mit seinen Höhen und Tiefen mithilfe von Kunst auszudrücken und zu verarbeiten. Die Werke zeigen Figuren, abstrakte Formen oder auch aufwendige Installationen.
Auch viele bekannte Künstler:innen griffen auf die Kunst zurück, um ihre Gefühlswelt abzubilden. Vincent Van Gogh, Frida Kahlo und Edvard Munch gehören nicht nur zu den grössten Künstler:innen der Welt, sondern litten alle an psychischen Erkrankungen, die sie in ihren Gemälden darstellten. Depressionen, Schizophrenie, bipolare Störung, Halluzinationen oder Wahnvorstellungen wurden mithilfe von Farbe auf einer Leinwand abgebildet.
„Im künstlerischen Schaffen verarbeitet man Erlebtes und tiefe Gefühle. Gerade während des Prozesses werden neue Sichtweisen und Erkenntnisse gewonnen, teilweise auch unterbewusst.”
Nora Gast, Kunsttherapeutin
Wieso bei psychischen Problemen auf die Kunst zurückgegriffen wird, erklärt die Kunsttherapeutin Nora Gast: «Im künstlerischen Schaffen verarbeitet man Erlebtes und tiefe Gefühle. Gerade während dieses Prozesses werden neue Sichtweisen und Erkenntnisse gewonnen, teilweise auch unterbewusst.» Weiter führt Gast aus, sei das «vor sich hin malen» genauer betrachtet, eine Art unterbewusste Selbstreflexion. In der Kunsttherapie analysiere man diese Art der Reflexion genauer, um der betroffenen Person zu helfen, mit ihren Emotionen umzugehen.
Neben der Verarbeitung und Abbildung der Geschlechtsidentität nutzt An die Kunst, um Gefühle widerzuspiegeln. Schon früher hat An abstrakte Selbstporträts hergestellt. Auf den ersten Blick schienen diese Werke jedoch keine direkte Reflexion zu sein. Mal waren es zwei Gestalten, die sich an den Händen hielten, ein anderes Mal war es ein mit Fell bezogener Tisch. «Ich stelle mich selbst dar. In jedem Werk, egal wie abstrakt oder seltsam es aussehen mag, steckt ein Teil meines Ichs», so die Künstler:in.
“Ich stelle mich selber dar. In jedem Werk, egal wie abstrakt oder seltsam es aussehen mag, steckt ein Teil meines Ichs. Auch die nicht so schönen Seiten”
An:ne Klepel, Künstler*in
Kunst als legitimes Mittel für die Problemlösung
«Das kreative Arbeiten bietet die Möglichkeit, Gefühle oder Ängste auf eine Weise darzustellen, die mit Worten nicht beschreibbar sind», erklärt Kunsttherapeut Stephan Mathys. Durch diese Darstellungsmöglichkeiten können Emotionen kommuniziert werden, die sonst nur schwer ans Tageslicht gekommen wären. Bei der Kunsttherapie seien Patient:innen oder auch Personen, die ausserhalb einer Therapie Kunst als Mittel nutzen, nicht nur auf die verbale Kommunikation limitiert.
Somit kann Kunst eine Möglichkeit sein, sich gestalterisch zu betätigen und dabei einen Weg zu finden, Gefühle auszudrücken, Konflikte zu bearbeiten, Selbstvertrauen aufzubauen oder schwierige Lebensabschnitte zu bewältigen.
So erklärt An, dass die Kunst auch ein Mittel sein kann, um aus einem «Gedankenstrudel» ausbrechen zu können. «Ich habe das Gefühl, wenn ich nicht am Arbeiten bin, bleiben meine Gedanken an einem Thema hängen. Dann beginnt das «Overthinken». Man ist gefangen in seinen Gedanken», erklärt die Künstler:in. Beim Arbeiten sei man in einem Fluss und merke, dass die Gedanken einfacher fliessen und nicht an einem Ort rotieren. Dies habe einen positiven Einfluss auf die mentale Gesundheit, so An.
Bei einer Behandlung von psychiatrischen Erkrankungen greife man zum Teil auch auf die Kunst zurück, so Mathys. Bei beispielsweise Depressionen, Essstörungen, Angststörungen oder Krebserkrankungen werde die Kunst zu einer Ausdrucksform für das Unfassbare, erklärt der Kunsttherapeut
“Es braucht seine Zeit, bis man sich öffnet und die Werke etwas zu erzählen beginnen”
Stephan Mathys, Kunsttherapeut
Wie funktioniert eine Kunsttherapie?
Anders als der Name vermuten lässt, beginnt man bei einer Kunsttherapie nicht sofort mit der Kunst. «Bevor Patient:innen einen Stift in die Hand nehmen und aktiv Kunst machen, gibt es zuerst ein Gespräch», so Mathys. In der ersten Stunde liegt der Fokus auf dem Kennenlernen und es werden Vorbehalte «aus der Welt geschafft».
Erst in der zweiten Stunde wird sich künstlerisch ausgedrückt. So kann sichergestellt werden, dass die Patient:innen sich wohlfühlen, führt Mathys weiter aus.
Nach dem Kennenlernen beginnt der künstlerische Ausdruck: «Man setzt sich zu Beginn mit den Fragen ‘Wer bin ich und wie gehe ich mit mir um?’ auseinandersetzt und versucht, diese abzubilden», so der Kunsttherapeut.
Die ersten Bilder seien sehr verschlossen und die Patient:innen würden nicht viel von sich selbst preisgeben. «Es braucht seine Zeit, bis man sich öffnet und die Werke etwas zu erzählen beginnen», erklärt Mathys.
Im Verlauf der Therapie werde die innere Kommunikation immer offener und die anfängliche Abneigung vergehe. «Sobald die Patient:innen sich auf die Kunsttherapie eingelassen haben, können die entstandenen Werke zu einem Spiegel werden. Wie lange dieser Prozess geht, ist jedoch von Person zu Person verschieden», so der Kunsttherapeut.
"Man kann eine Person nicht zur Therapie zwingen, sie muss es von sich aus wollen"
Nora Gast, Kunsttherapeutin
Ein Blick in die Wissenschaft
Eine britische Studie des Perspectives in Public Health Journals aus dem Jahr 2018 belegt, dass die Teilnahme an Aktivitäten von Kunstprogrammen wie eine Kunsttherapie vorteilhaft ist. Diese können sowohl körperliche Symptome lindern als auch Gesundheitsprobleme verbessern. Die Studie rät zudem, dass solche Aktivitäten als nicht-medizinisches Instrument zur Förderung der öffentlichen Gesundheit und des Wohlbefindens eingesetzt werden können.
So sinnvoll wie die Kunsttherapie scheint, muss jedoch beachtet werden, dass sich diese Art der Therapie nicht für jede Person eignet, erklärt Nora Gast. «Jede oder jeder hat seine oder ihre eigenen Ansprüche, auf die Rücksicht genommen werden müssen.»
Es nütze nichts, wenn man jemanden zur Kunsttherapie zwingen will, zeigt Gast auf. Bei einer erzwungenen Therapie können die erhofften Ergebnisse nicht erreicht werden und die betroffene Person könne in gewissen Fällen ein Trauma davontragen und sich ganz verschliessen. Zudem seien die Kosten einer Kunsttherapie sehr hoch (ca. 130 CHF / 90 Minuten) und würden nicht von jeder Krankenkasse übernommen werden.
Bei dem Thema `Eigentherapie` ist Gast ähnlicher Meinung wie die Studie des Public Health Journals. Jedoch sei zu beachten, dass eine nicht medizinisch durchgeführte Therapie den Betroffenen nur bis zu einem gewissen Punkt weiterhelfen und eine professionelle Hilfe nicht ersetzen könne, erklärt die Kunsttherapeutin.
Gehen wir zurück in den 4. Stock der Zürcher Hochschule der Künste. Auch wenn es draussen schon längst dunkel ist, brennt im Atelier ein schwaches Licht. Die einst leere Leinwand ist nun mit unterschiedlichen Farbtönen bemalt. An konnte alle aktuellen Gefühle und Gedankenströme auf die Leinwand übertragen. An legt die Utensilien langsam zurück. Packt Pinsel und Farben zurück an ihren Platz. Schnappt sich die dunkle Jacke und verlässt das leicht nach Honig riechende Atelier.
Dieser Text erschien auch im KUMAG - Magazin